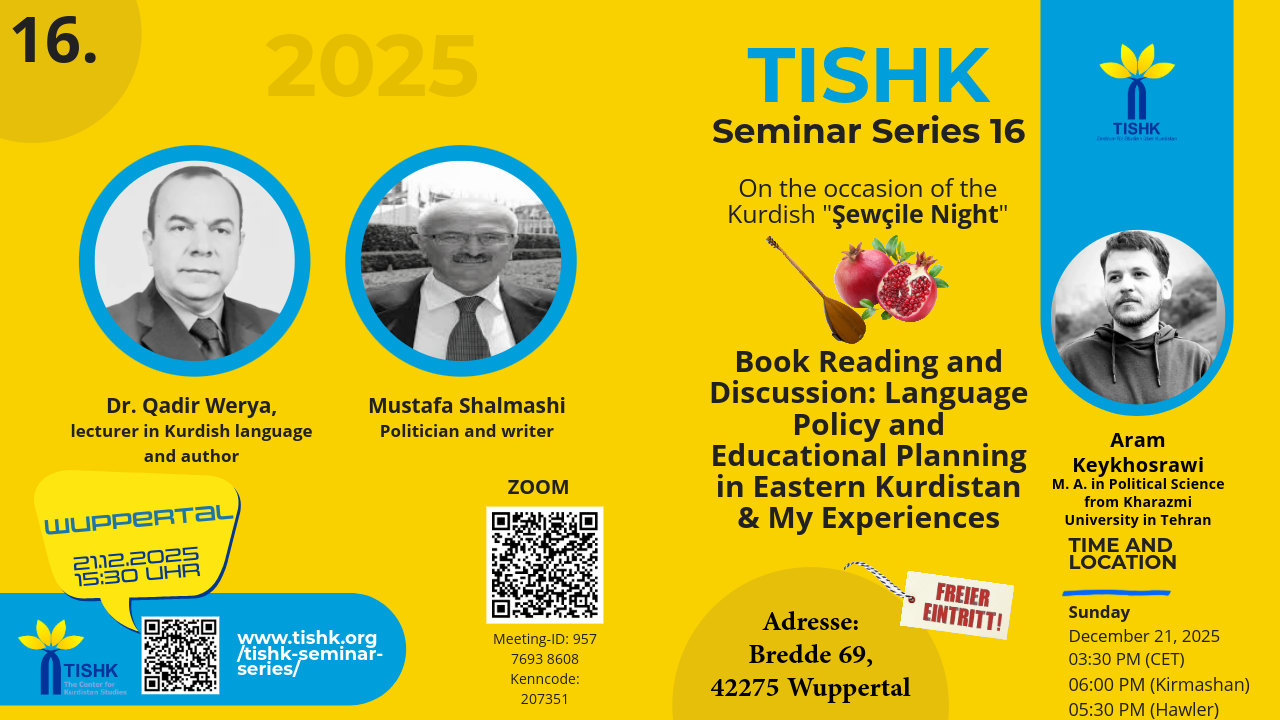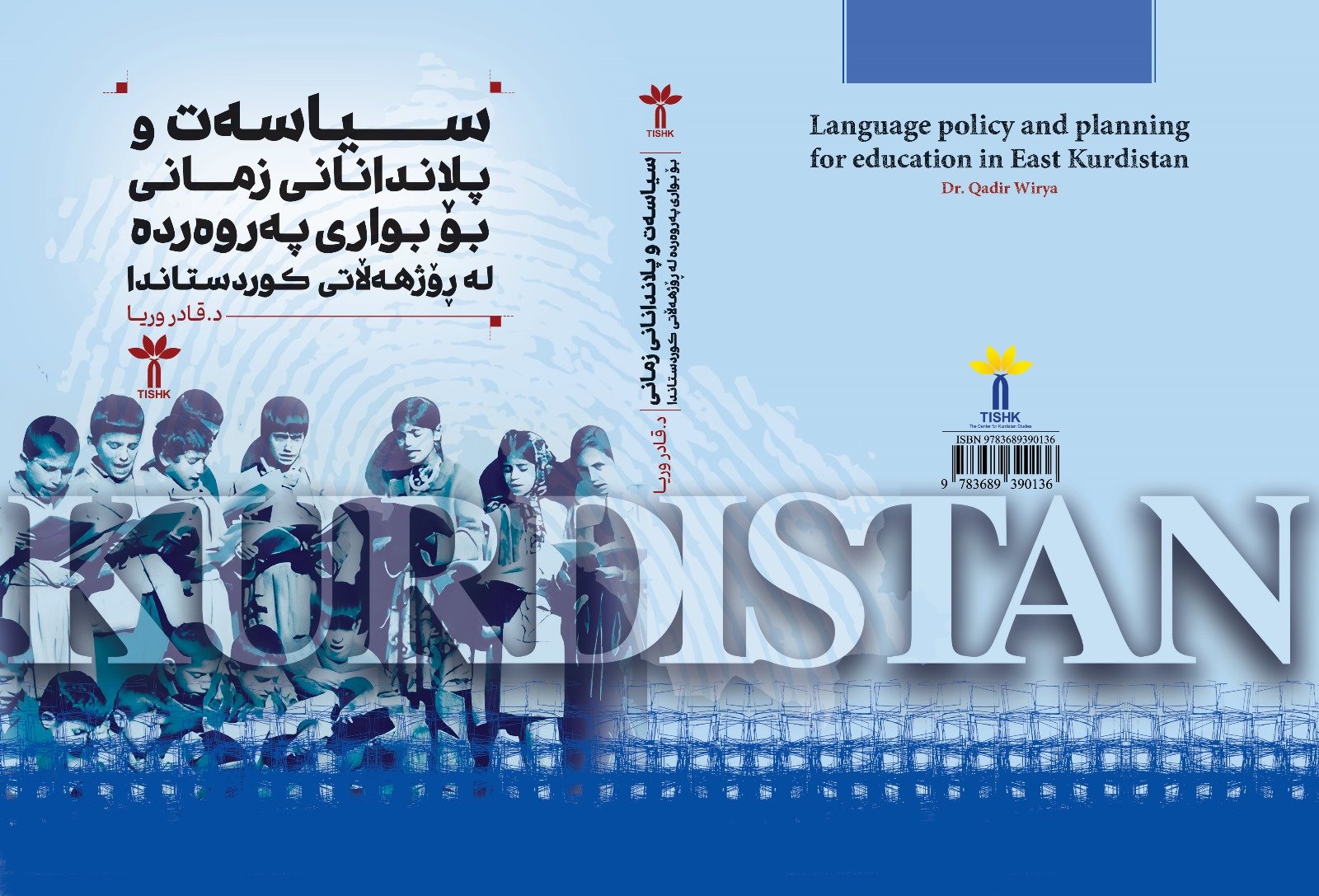OPINION
Völkerrecht und das Recht auf Selbstbestimmung: Der kurdische Fall im Iran
Online veröffentlicht von TISHK Zentrum für Kurdistan Studien: 28. Juli 2025
DOI
Eliassi, Baban (2025) Völkerrecht und das Recht auf Selbstbestimmung: Der kurdische Fall im Iran. Kurdistan Agora. TISHK – Zentrum für Studien in Kurdistan.
Zusammenfassung
Dieser Artikel untersucht das Recht auf Selbstbestimmung im Rahmen des Völkerrechts am Beispiel der Kurden in Ostkurdistan (Iran). Obwohl sie eines der größten staatenlosen Völker sind, unterliegen die Kurden im Iran einer systematischen politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und religiösen Unterdrückung. Die andauernden Auswirkungen von Ayatollah Khomeinis Fatwa (islamisches Dekret) aus dem Jahr 1979 gegen die kurdische Autonomie sowie die weitverbreitete Diskriminierung rechtfertigen den Anspruch der Kurden auf ein externes Selbstbestimmungsrecht. Unter Bezugnahme auf den völkerrechtlichen Rahmen und internationale Präzedenzfälle – wie Eritrea, Südsudan und Kosovo – argumentiert dieser Beitrag, dass das Völkerrecht eine Sezession erlaubt, wenn das Recht auf innere Selbstbestimmung verweigert wird.
.

Schlagwörter: Selbstbestimmung, Kurdische Rechte, Völkerrecht, Externe Sezession, Repression im Iran
Völkerrecht und das Recht auf Selbstbestimmung: Der kurdische Fall im Iran
Einleitung
Das Prinzip der Selbstbestimmung ist ein Grundpfeiler des Völkerrechts. Es ist in der Charta der Vereinten Nationen (1945) verankert, die in Artikel 1(2) das Ziel formuliert:
„Die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen auf der Grundlage der Achtung des Grundsatzes der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker zu fördern.“
Darüber hinaus beginnt sowohl der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) als auch der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR) mit einem identischen Artikel 1(1), der erklärt:
„Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts bestimmen sie frei ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.“
Absatz 3 desselben Artikels ergänzt:
„Die Vertragsstaaten dieses Paktes […] fördern die Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung und achten dieses Recht.“
Auch die Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker (UN-Generalversammlungsresolution 1514, 1960) bekräftigt:
„Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung; kraft dieses Rechts bestimmen sie frei ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.“
Entwicklung des Prinzips der Selbstbestimmung
Ursprünglich auf die Entkolonialisierung beschränkt, hat sich das Prinzip der Selbstbestimmung weiterentwickelt und umfasst heute sowohl die innere Selbstbestimmung (z. B. Autonomie oder Föderalismus) als auch unter bestimmten Umständen die äußere Selbstbestimmung (d. h. Sezession), insbesondere in Fällen systematischer Unterdrückung oder schwerer Menschenrechtsverletzungen (Cassese, 1995). Die Broschüre des CETIM (Özden & Golay, 2018) erweitert diesen Rahmen zusätzlich, indem sie betont, dass Selbstbestimmung auch dauerhafte Souveränität über natürliche Ressourcen, wirtschaftliche Gerechtigkeit und kulturelle Autonomie einschließt.
Die Präambel der UN-Charta erkennt ausdrücklich das Recht der Völker an, sich gegen Unterdrückung zu wehren, und legitimiert solche Ansprüche unter extremen Bedingungen (UN, 1945). Artikel 1(2) und 55 der Charta sowie Artikel 1 der beiden UN-Pakte verankern die Selbstbestimmung als ein grundlegendes kollektives Recht, das die Staaten verpflichtet, Bedingungen für Selbstverwaltung und gleichberechtigte Teilhabe zu schaffen (UN, 1966a; 1966b). Die UNGA-Resolution 2625 (1970) stellt klar, dass äußere Selbstbestimmung legitim beansprucht werden kann, wenn ein Volk durch systematische Unterdrückung an innerer Selbstbestimmung gehindert wird.
Die kurdische Situation im Iran
Laut Amnesty International (2008) leben im Iran schätzungsweise 10 bis 12 Millionen Kurden, was sie zu einer der größten staatenlosen Bevölkerungsgruppen der Region macht. Dennoch sind sie schwerwiegender und systematischer Diskriminierung ausgesetzt:
-
Rechtliche und verfassungsrechtliche Diskriminierung: Obwohl Artikel 15 der iranischen Verfassung die Verwendung regionaler Sprachen in Medien und Bildung erlaubt, ist der kurdische Sprachunterricht in der Praxis stark eingeschränkt. Es gibt keine offizielle politische Repräsentation oder Anerkennung kurdischer Autonomie.
-
Religiöse Diskriminierung: Die Mehrheit der Kurden im Iran ist sunnitisch in einem schiitisch dominierten Gottesstaat, was ihren Zugang zu staatlichen Ressourcen und Machtpositionen erheblich einschränkt (ICG, 2017).
-
Kulturelle Repression: Kurdische Kleidung, Namen, Literatur und Feste wie Newroz werden häufig verboten oder unterdrückt, was eine Verletzung kultureller Rechte darstellt (UN-Sonderberichterstatterin für kulturelle Rechte, 2019).
-
Politische Repression: Kurdische Aktivist:innen werden überproportional wegen Verbrechen wie „Moharebeh“ (Feindschaft gegen Gott) angeklagt und inhaftiert oder hingerichtet (Amnesty International, 2021; HRW, 2020). Mehrere Berichte zeigen, dass ein Großteil der im Iran hingerichteten politischen Gefangenen Kurden sind (UN-Menschenrechtsrat, 2022).
-
Wirtschaftliche Marginalisierung: Trotz großer Ressourcenreserven (z. B. Öl und Gas) bleiben kurdische Regionen unterentwickelt und staatlich vernachlässigt (Weltbank, 2018).
Nach der Revolution von 1979 erließ Ayatollah Khomeini eine Fatwa, die einen Dschihad gegen die kurdische Bevölkerung ausrief und ihre Autonomiebestrebungen als „Fitna“ (Aufruhr) brandmarkte. Diese Fatwa führte zu Bombardierungen, Militäroperationen und Massenhinrichtungen in Kurdistan (Gunter, 2011).
Diese Fatwa besitzt weiterhin symbolische religiöse Gültigkeit und erzeugt anhaltende Angst unter den Kurden. Viele befürchten, dass gegenwärtige oder zukünftige theokratische Regierungen sie erneut aktivieren könnten. Dieses anhaltende religiöse Dekret hat tiefgreifende psychologische Auswirkungen und schafft ein Klima der Angst und Unsicherheit. Religion wird, wie einst unter Saddam Hussein mit der Sure Al-Anfal zur Rechtfertigung des Völkermords an den Kurden 1988, auch im Iran instrumentalisiert, um systematische Gewalt und kulturelle Auslöschung zu legitimieren.
Internationale Präzedenzfälle zur Unterstützung äußerer Selbstbestimmung
Mehrere internationale Beispiele untermauern das Recht auf äußere Selbstbestimmung:
-
Eritrea (1993): Erreichte nach einem von der UNO überwachten Referendum die Unabhängigkeit von Äthiopien.
-
Südsudan (2011): Erlangte nach systematischer Unterdrückung und einem Friedensabkommen die Staatlichkeit.
-
Kosovo (2008): Erklärte die Unabhängigkeit, die der Internationale Gerichtshof (IGH) 2010 als nicht völkerrechtswidrig bestätigte.
Diese Beispiele zeigen, dass äußere Selbstbestimmung dann zulässig ist, wenn innere Selbstverwaltung verweigert und Menschenrechte verletzt werden (IGH, 2010; Arbour, 2008).
Die Afrikanische Kommission für Menschen- und Völkerrechte erkannte 2001 im Fall Katangese Peoples’ Congress gegen Zaire an, dass schwere Repression das Recht auf äußere Selbstbestimmung legitimieren kann.
Wirtschaftliche Souveränität und Kontrolle über Ressourcen
Wirtschaftliche Souveränität ist ein integraler Bestandteil der Selbstbestimmung. Obwohl kurdische Regionen reich an Öl und Gas sind, werden die Gewinne zentralstaatlich vereinnahmt. Laut Özden & Golay (2018) stellt wirtschaftliche Ausbeutung ohne Beteiligung an den Erträgen eine Verletzung des Rechts auf dauerhafte Souveränität über natürliche Ressourcen dar.
Fazit
Das kurdische Volk im Iran leidet unter politischer, kultureller, wirtschaftlicher und religiöser Unterdrückung, die gemäß Völkerrecht Ansprüche auf äußere Selbstbestimmung rechtfertigen. Die andauernde Wirkung von Khomeinis Fatwa sowie die unverhältnismäßig hohe Zahl hingerichteter und inhaftierter kurdischer Aktivist:innen zeugen von einer gezielten staatlichen Repressionsstrategie. Die symbolische Macht der Fatwa hinterlässt zudem einen tiefen psychologischen Abdruck in der kollektiven Erfahrung der Kurden und verstärkt das Gefühl der Unsicherheit.
Wenn innere Selbstbestimmung dauerhaft verweigert wird, erlaubt das Völkerrecht die Verfolgung äußerer Selbstbestimmung – wie verschiedene Präzedenzfälle bestätigen. Dennoch bleibt die Verwirklichung dieses Rechts stark von geopolitischen Rahmenbedingungen abhängig.
Literaturverzeichnis
- Amnesty International. (2008). Iran: Human rights and the Kurdish minority. Amnesty International Publications.
- Amnesty International. (2021). Iran: Executions and political repression.
- Arbour, L. (2008). Report of the Independent Expert on the Promotion of a Democratic and Equitable International Order. United Nations.
- Cassese, A. (1995). Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal. Cambridge University Press.
- Gunter, M. M. (2011). The Kurds Ascending: The Evolving Solution to the Kurdish Problem in Iraq and Turkey. Palgrave Macmillan.
- Human Rights Watch (HRW). (2020). Iran: Repression of Kurdish Political Activists.
- International Court of Justice (ICJ). (2010). Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo. Advisory Opinion.
- International Crisis Group (ICG). (2017). Iran’s Kurdish Question.
- Özden, F., & Golay, C. (2018). Le droit des peuples à l’autodétermination, à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles et à la justice économique. CETIM.
- United Nations (UN). (1945). Charter of the United Nations.
- United Nations (UN). (1966a). International Covenant on Civil and Political Rights.
- United Nations (UN). (1966b). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
- United Nations General Assembly (UNGA). (1960). Resolution 1514 (XV) – Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples.
- United Nations General Assembly (UNGA). (1970). Resolution 2625 (XXV) – Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States.
- United Nations Human Rights Council. (2022). Report on the Situation of Political Prisoners in Iran.
- United Nations Special Rapporteur on Cultural Rights. (2019). Report on the Cultural Rights of Minorities.
- World Bank. (2018). Iran: Economic Overview and Regional Disparities.
TISHK News